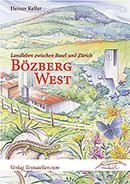Herbert
Von Thomas Jancke, Lörrach D
Es liegt etwa ein halbes Jahrhundert zurück. Ich war noch nicht lange Lehrer an einer Hamburger Gewerbeschule, da hatten wir uns mit einem Schulkollegen namens Herbert und seiner Frau Christa angefreundet. Herbert, obgleich gebürtiger Ostpreusse, war leidenschaftlicher Bergsteiger, eine nicht seltene Merkwürdigkeit, so wie viele Bayern eine Vorliebe für die Seefahrt bei der Marine haben. Herbert hatte es schon so weit gebracht, dass er in seinen Sommerferien auf einer österreichischen Bergsteigerschule als Lehrer fungierte. Ich dagegen hatte nur ein einziges Mal einen Berg, nämlich den Wendelstein, mit Hilfe einer Bergbahn bestiegen.
Als wir einmal bei Herbert und Christa eingeladen waren, sahen wir zufällig im TV – eine damals noch neue Attraktion, die wir uns erst fünfzehn Jahre später leisteten – eine Sendung über den damals neuen Trentiner Bergsteiger Chor. Ich war von den wunderschönen Bildern so beeindruckt, dass ich Herbert fragte, ob er mich nicht einmal auf eine Bergtour mitnehmen würde. Herbert war sogleich bereit, aber ich hatte Bedenken, ob ich so einen 8-Tage-Rucksack die Berge hinauftragen könne; ob er mir nicht einmal seinen Rucksack mit Büchern füllen würde, ich hätte ihn gern mal die 5 Stockwerke in dem alten Hamburger Mietshaus hoch getragen, in welchem sie damals wohnten. Der Test fiel so positiv aus, dass Herbert unsere erste Bergtour für den Sommer einplante.
Bevor ich nun versuche, aus diesen Jahrzehnte zurückliegenden Bergtouren in meinem Gedächtnis etwas aufzustöbern, was sich aufzuschreiben lohnt, weise ich darauf hin, das mich Herbert, welcher, seit Jahren an den Rollstuhl gefesselt, ein treuer Leser meiner Briefberichte ist, mich darum gebeten hat, denn er lebt nun aus seinen Erinnerungen.
Damals hat er mir eine Welt eröffnet, von deren Existenz ich nichts wusste, eine Wunderwelt, die niemand vergessen kann, der sie einmal erlebt hat. Den zauberhaften Reiz des Hochgebirges findet man nicht dort, wo Touristen oder Skifahrer mit Bergbahnen hinaufgebaggert werden, sondern nur dort, wo man seinen Rucksack 1000 oder 2000 m hinaufgetragen hat. Das Erlebnis der eigenen Leistungsfähigkeit, der Geschicklichkeit und des Mutes beim Bewältigen schwieriger und lebensgefährlicher Passagen und Klettereien, dazu das Bewusstsein, aus der Masse derer herausgehoben zu sein, die, aus welchen Gründen auch immer, niemals in diese Regionen hinauf gelangen. Die Schönheit der Bergwelt und der Verzicht auf alle gewohnten Bequemlichkeiten und Leckereien – alles zusammen – erzeugen ein neuartiges Hochgefühl. Wenn dann nach einigen Tagen beim Neuling die Gewöhnung an den Anblick schwindelnder Abgründe und steile Gipfel sowie die physische Gewöhnung an die Höhenluft zwischen 2000 und 4000 m bewältigt ist, wenn man täglich etliche Stunden bergauf bergab durch die Schönheiten des Hochgebirges wandert, gewöhnt man sich derartig an dieses Hochgefühl, dass es einen immer wieder hinauf in die Berge zieht, solange einen die Beine tragen.
Herbert war von Statur keineswegs athletisch und kaum mittelgross. Aber bärtig, kantig und mit einer volltönenden, etwas metallisch klingenden Stimme hatte er doch eine imponierende Ausstrahlung, und man traute ihm durchaus eine führende Rolle in einer Bergsteigerschule zu, in der Mut und Selbstüberwindung zu einem befriedigenden Ergebnis führen. Was ihn für mich besonders anziehend machte, waren seine Fröhlichkeit und sein Witz. In mir fand er wohl einen unterhaltsamen Ausgleich für seine oftmals schroffe und kompromisslose Art, mit der er sich manchmal eher Probleme schuf als sie löste. So sind wir über die Jahrzehnte immer gute Freunde geblieben.
Unsere Hochgebirgstouren bereitete Herbert immer akribisch vor, und da es damals noch kein Internet gab, war dafür ein sorgfältiges Studium von Karten und Alpenverein-Literatur nötig. So war er für mich ein idealer Begleiter, denn ich war zwar konditionsstark, trittsicher und schwindelfrei, hatte aber einen schlechten Orientierungssinn.
Unsere erste Bergtour war nicht etwa eine leichte Anfängertour, etwa in den Voralpen des Allgäus, sondern eine richtige Hochtour in die Dolomiten, und zwar in die Brenta-Gruppe.
Wir trafen uns in dem vom Ski-Weltcup her berühmten Madonna di Campilio in Südtirol, wo wir uns ein einfaches Bergsteiger-Quartier suchten und am nächsten Morgen mit unseren 8-Tage-Rucksäcken aufstiegen. Beinahe wüsste ich noch den Namen der Hütte, in der ich meine erste Nacht zubrachte (Tuckett Hütte?), aber zum Abendessen gab es ein einfaches Gericht, welches früher bei uns Tomatennudeln genannt wurde, das ich immer liebte und das hier oben „pasta asciutta“ hiess. Es war nicht wirklich billig, denn in den Hochgebirgshütten ist nichts billig, aber doch das billigste und schmackhafteste warme Gericht, und deshalb haben wir es auf nahezu allen Hütten gegessen. Den Neuling erstaunt es auch, dass es die Kanne mit dem heissen Wasser, welches man morgens für den Tee braucht, keineswegs kostenlos gibt. Prinzipiell gibt es nur die Alternative, entweder viel Gewicht oder viel Geld mitzunehmen. Letzteres hatten wir natürlich nicht, und da man ja auch Frühstück und eine Mittagsvesper braucht, kommt in so einem 8-Tage-Rucksack einiges zusammen. Auch die Ausrüstung hat ihr Gewicht. Da diese erste Tour keine Gletscherquerungen enthielt, konnten wir auf Seil und Steigeisen verzichten. Den Pickel nimmt man immer mit, und Herbert verzichtete auch nie auf seine schwere Leica, mit der er wunderschöne Fotos machte.
Wir durchquerten die Brenta-Gruppe auf einer „via ferrata“, d. h. auf einer Felsroute, welche an besonders gefährlichen Passagen mit Stahlseilen gesichert war, an denen man sich festhalten kann, aber nicht muss, und an senkrechten Felswänden mit eisernen Leitern versehen ist. Typisch für diese Route sind die so genannten Felsbänder, das sind in gewaltigen, senkrechten Felswänden durch Erosion entstandene, nahezu waagerechte, schmale Wege auf einer ein wenig vorspringenden Kante, auf der man verhältnismässig bequem gehen kann, wenn es einen nicht stört, dass die Kante schmal ist und auf einer Seite offen ins Bodenlose abstürzt. Die Leitern sind auch nicht so recht gemütlich, denn die vielen Bergsteiger mit ihren schweren Rucksäcken üben beim Hochklettern einen starken Zug nach aussen aus, und so hatten sich oft die Verankerungen im Fels gelöst, und die Leitern hatten einen unbehaglichen Bogen nach aussen bekommen, den man überwinden musste. Oben angekommen, hörte die Leiter auf, indem sie nur im waagerechten Fels befestigt war; es gab dann nichts mehr für die Hände zum Festhalten, und man musste sich auf dem Bauch über die Kante schieben.
Nun, das liegt einige Jahrzehnte zurück, und es war noch die Erstausstattung einer damals staunenswerten Neuerung. Inzwischen wird alles sehr viel perfekter sein. Auf den Hütten kam für uns nur das durchgehende Matratzenlager in Frage, wo es passieren konnte, dass einem nachts ein Marder über die Füsse lief. Aber die Brenta-Gruppe mit ihren gigantischen Felsformationen, z. B. mit dem Campanile alto und dem Campanile basso, ist von imponierender Schönheit, und wenn man abends vor der Hütte erlebte, wie die Abendsonne das Felsmassiv mit einem warmen Rot anstrahlte, so war das für mich ebenso wunderbar wie der erregende Gedanke an den nächsten Tag. Herbert nahm dann oft sein Fernglas und suchte die Ferne nach Merkmalen ab, welche Hinweise auf die Route am nächsten Tag gaben.
Einmal schien es von Weitem, als ob unser Tagesziel aus 2 direkt nebeneinander liegenden Hütten bestünde. Es stellte sich dann aber heraus, dass die zweite Hütte ein massiver Felsblock war, gross wie ein Haus und auch von kubischer Form. Er war einige Jahre zuvor in der Nacht herabgestürzt und unmittelbar vor der Hütte zum Halten gekommen. Diese Hütte hatte nun ihre Attraktion.
Auf dieser ersten Tour war kein schlechtes Wetter. Es war alles so gut und glücklich abgelaufen, und ich hatte mich als so hochgebirgstauglich erwiesen, dass wir in den folgenden 8 oder 9 Jahren jedes Jahr wieder eine Hüttentour unternahmen. Wir passten wirklich gut zueinander, hatten uns immer etwas zu erzählen oder zu lachen. Für die Abendstunden auf der Hütte oder wenn wir einmal besseres Wetter abwarten mussten, hatte Herbert einen Würfelbecher, Papier und Bleistift in seinem Gepäck, und wir vertrieben uns manche Stunde mit Jazzi oder „Chicago“, und da Herbert auf dem Bauch zu schlafen pflegte, hatte ich immer 2 Kopfkissen, was mir sehr zustatten kam.
Ich weiss die Reihenfolge unserer Touren nicht mehr, aber wir waren am Grossglockner und im Berner Oberland, im Rätikon und in der Adamello-Gruppe, auf dem Ortler und dem Cevedale. Eine Woche verbrachten wir im Wilden Kaiser in der Kletterschule, und unsere letzte Tour ging in den Catenaccio, auf Deutsch: den Rosengarten. Das heisst, vorzugsweise waren wir in den Ostalpen, welche weniger hochalpin und schwierig sind. Nebenher oder später war ich mit anderen Begleitern auf dem Wildstrubel und dem Mönch, auf Bergtouren im Berner Oberland, auf dem höchsten Tessiner Gipfel, dem Campo Tencia, und 12 Mal auf dem 2445 m hohen Pizzo di Vogorno, unserem Tessiner Hausberg.
Zu Beginn unserer zweiten Tour nächtigten wir in einer Privatpension an der Grossglockner-Hochalpenstrasse, wo wir auch unsere Autos lassen konnten, und gingen eine Tour, die sich im Wanderbuch des Alpenvereins „Rund um den Grossglockner“ nannte. Es war eine besonders reizvolle Tour, und die Eindrücke stehen noch jetzt, nach etlichen Jahrzehnten, lebhaft vor meinem inneren Auge. Es waren warme, sonnige Hochsommertage, und von den vielen Gletschern, welche dort Kees (?) genannt wurden, schmolz das Eis und bildete überall sprudelnde Bäche.
Zum ersten Male sah ich die imponierenden grossen Gletschertore, in denen sich das abfliessende Schmelzwasser sammelte. Wir inspizierten eines aus der Nähe und begaben uns ein wenig in die märchenhafte, blaue Eisgrotte hinein.
Die Besteigung des Grossglockners gehörte nicht zu dieser Tour, aber wir bestiegen den fast ebenbürtigen Gipfel des Grossen Wiesbachhorns, einen vergletscherten Gipfel, welchen Herbert vor Jahren bestiegen hatte, und wir hatten unsere Steigeisen mitgenommen. Aber zu seiner Enttäuschung brauchten wir sie nicht, denn der Gletscher war weitgehend abgeschmolzen, wie so viele in den Alpen als Folge der Klimaänderung. Wir überquerten mehrere Passübergänge, dort „Törl“ genannt, und eine Hochebene mit den seltsamsten, durch Korrosion entstandenen Steinformationen, z. B. wie Blätterteig geschichtete Felsblöcke und einer dieser Hochebenen war bedeckt mit den schönsten, gemusterten und gefärbten Steinen, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Man hätte gern einige davon als Andenken mitgenommen, aber es kommen ja noch viele Bergsteiger nach uns, die sich daran freuen sollen, und ausserdem sind Steine nun einmal nicht leicht im Gepäck.
An einem grossen, modernen Bergsteigerhotel mit Seilbahn ins Tal und innen Übungswänden für die Kletterschule waren wir gerade noch rechtzeitig vor einem Gewitter angekommen, und wir waren an der Fassade entlang auf der Suche nach dem Eingang, als ein Blitz mit ohrenbetäubendem Donnerschlag so unmittelbar neben uns einschlug, dass wir beide den Eindruck hatten, um Haaresbreite dem Tode entronnen zu sein. Es übertraf alles, was ich in dieser Hinsicht im Tessin je erlebt habe.
Ich war 7 Jahre älter als Herbert, so um die 50 Jahre alt, also nicht gerade ein Jüngling mehr, und irgend jemand hatte mich auf eine praktische Neuerung aufmerksam gemacht, nämlich dass der Gebrauch von 2 Skistöcken sich langsam durchsetze, denn es würde eine wesentliche Entlastung und Schonung der Kniegelenke auf den langen Hüttenanstiegen am Ende eines anstrengenden Tages erreicht. Das leuchtete mir ein, und da es mir nicht um meine Reputation zu tun war, hatte ich sie auf dieser Tour erstmalig mitgenommen. Gewiss entsprach der Anblick eines Bergsteigers mit 2 Stöcken nicht dem gewohnten Vorbild eines Louis Trenker, und Herbert, zünftig, und sogar Berglehrer, war es auch nicht ganz wohl in Begleitung eines solchen Vierbeiners. Aber es kam beim Überqueren eines breiten Gletscherbaches über einige wackelige Steine die Situation, dass Herbert, nachdem ich mit meinen Stöcken komfortabel hinübergelangt war, sich von mir einen Stock zuwerfen liess.
Einen Tag darauf erreichten wir entlang eines langen Stausees ein Berghotel oberhalb von Zell am See, wo Herbert eine Bergsteigerschule gut kannte, welche ein von ihm verehrter Bergprofessor, namens Moravec leitete. Der Professor war noch nicht von seiner Tagestour zurück, und wir bezogen in der danebenliegenden, einfachen Berghütte unser Quartier. Dann sahen wir draussen den Professor an der Spitze seiner Gruppe ankommen, sowohl er, als auch seine Schüler mit je 2 Skistöcken! Ich konnte eine gewisse Genugtuung nicht verbergen.
Vom Ende dieser Tour erinnere ich mich noch grosser Wiesenhänge, ganz blau von Eisenhut, und eines schweren Anstiegs über 1500 m, der über abenteuerliche Schrofenhänge führte, welche in der Tourenbeschreibung etwas dramatisiert als „fast senkrecht“ bezeichnet waren. Aber es waren einige etwas mitgenommene Drähte gespannt, an denen man sich festhalten konnte.
Für eine Tour in den Rätikon, eine zwischen Österreich und der Schweiz gelegenen Bergkette, kam mich Herbert im Tessin abholen. Ich hatte damals gerade ein Dach über unserer Kaminterrasse fertig gestellt und aussen eine Regenrinne montiert, als auch schon ein Gewitter aufzog. Herbert und ich standen in der offenen Tür um das abfliessende Wasser des Wolkenbruchs zu beobachten, als es plötzlich hinter uns im Zimmer einen scharfen Knall gab. Wir fuhren herum und sahen, wie sich Renzi nach einem Moment der Lähmung von ihrem Stuhl am Fenster erhob und sich auf die Couch warf. Ein so genannter kalter Kugelblitz war an uns vorbei durch die offene Tür an dem Telefondraht entlang gelaufen und an der Stelle, wo dieser vom Antennendraht gekreuzt wurde, direkt neben Renzis Hüfte geplatzt. Sie hatte einen schweren Schlag bekommen und ein rotes Brandkreuz auf der Hüfte. Gottlob erholte sie sich schnell von dem Schreck und schien auch sonst keine bleibenden Schäden erlitten zu haben, so dass Herbert und ich uns am nächsten Morgen auf unsere Bergtour begaben. Von ihren später auftretenden Spätfolgen wussten wir noch nichts. So war ich eine Woche lang für Renzi unerreichbar, denn Handys gab es damals noch nicht und wir hatten in Valegiascia noch kein Telefon.
Wir waren von Schruns in den Rätikon aufgestiegen und erreichten über einen z. T. mit Drahtseilen und Leitern gesicherten, romantischen Felsensteig in ca. 2800 m Höhe den Brandnergletscher.
Leider war das Wetter schon unterwegs mässig, so dass wir im Anstieg von dem reizvollen Panorama wenig zu sehen bekamen, und auf dem Gletscher empfing uns dichter Nebel.
Zu unserem Glück hatte es nicht frisch geschneit, und so konnten wir einen Trampelpfad über den Gletscher erkennen, der kein anderes Ziel als die Mannheimer Hütte haben konnte. Ohne diesen und ohne Kompass hätten wir keine Chance gehabt, die Hütte zu erreichen, denn die Sichtweite betrug nicht mehr als 2 Meter. Wir tasteten uns behutsam durch den Nebel.
Bisweilen gluckste und knackte es unter unseren Füssen, und wir sehnten das Ende dieser blinden Querung herbei.
Endlich tauchte eine dunkle Wand aus dem milchigen Einerlei auf. Der jenseitige Gletscherschrund, an welchem steil ansteigendes Felsgeröll begann, bestand aus tiefem Schneematsch und Schneewasser, in welches Wanderer einige wackelige Steine als Tritte gelegt hatten. Es ging nicht ohne nasse Füsse ab, das Wasser lief oben in die Schuhe hinein; ein widerliches Gefühl, das ausserdem unangenehme Perspektiven für den weiteren Weg am nächsten Tag eröffnet, wenn man keine Möglichkeit hat, die Schuhe über Nacht zu trocknen.
Im Felsgeröll gab es zwar keinen Weg mehr, der uns die Richtung hätte weisen können, aber bald drang ein Motorengeräusch an unsere Ohren, das von der Hütte herrühren musste. Und schon tauchte im Nebel ein Gebäude vor uns auf, in das wir sogleich hinein schauten.
Ein grosses Diesel-Stromaggregat erzeugte ausser Lärm auch köstliche Wärme, und auf Regalen und Haken trockneten schon Bergstiefel und Anoraks. Nachdem wir dieser Einladung, unsere nassen Schuhe auszuziehen, nur zu gern gefolgt waren, betraten wir auf Turnschuhen die Hütte und inspizierten nach unserer Gewohnheit erstmals die Schlafgelegenheiten, bevor wir uns im Tagesraum meldeten. (Wenn man nämlich vom Hüttenwirt gefragt wird, ob man „Lager“ oder „Bett“ will, hat man schon eine gute Entscheidungshilfe, denn ein nettes, geräumiges „Lager“ für sich allein ist billiger als das teure „Bett“.)
Bei dem schlechten Wetter waren wenige Gäste auf dieser hochgelegenen Hütte, und der Hausherr war aufgeschlossen und gesprächig, was bei Hüttenwirten eher die Ausnahme ist.
Wie er uns sagte, sorge er normalerweise für Nebelsignale, aber das Horn habe versagt. Er habe früher schon einige Rettungen auf dem Gletscher durchführen müssen. Wer sich verirrt, liefe unweigerlich im Kreis.
Und dann kam er im Laufe des recht behaglichen Abends auf eine Begebenheit zu sprechen, welche eigentlich in meine Tessiner Geschichten gehört. Sie führt nämlich auf ein richtiges Horror-Erlebnis mit seiner Seilbahn.
Diese verbindet die 1000 m tiefer gelegene Oberzalim-Hütte, welche von seiner Frau bewirtschaftet wird, mit der Mannheimer Hütte am Brandnergletscher. Die Oberzalim-Hütte ist mit einem Jeep vom oberen Brandnertal aus erreichbar, und so werden beide Hütten von unten versorgt. Der Hüttenwirt, Herr Konzett, fährt regelmässig mit der Seilbahn in einem geräumigen, überdachten Kasten hinunter und wieder hoch. Er bringt Versorgungsgüter, bisweilen auch einen Gast oder Gepäck mit hinauf.
Zwischen den beiden Hütten liegt eine riesige, nahezu senkrechte Felswand von mehreren hundert Metern Höhe, und die Seilbahn geht freitragend ohne Stützen über gewaltige Abgründe.
Nicht lange zuvor hatte Herr K. ein schweres Gewitter in der Oberzalim-Hütte bei seiner Frau abgewartet und war darauf wieder nach oben gefahren. Ein junger Helfer bediente oben den Motor.
Dass Stahlseile Blitze fangen, ist bekannt, und man sollte sich bei Gewitter möglichst nicht in ihrer Nähe aufhalten. In diesem Falle aber hatte ein Blitz mit solcher Wucht in das Seil geschlagen, dass einer von den dicken Stahldrähten, aus denen das Seil zusammengedreht ist, durchgeschlagen war, und die beiden Drahtenden vom Seil abstanden.
50 m vor der oberen Station, über dem Abgrund fahrend, sah K. plötzlich, wie sich vor der vorderen Rolle seines Laufwerks ein Drahtknäuel sprungfederartig ringelte und zusammenschob. Es durchfuhr ihn ein lähmender Schreck, die Rollen mussten jetzt vom Seil springen und der Wagen abstürzen. Da geschah das Wunder: die Rollen sprangen über das Drahtknäuel, erst die vordere, dann die hintere und landeten richtig wieder auf dem Seil. Er war dem Tode entronnen und noch immer voll von diesem Erlebnis. Eine Seilbahnfirma hatte dann die gefährlichen Enden verplombt, aber das Seil sollte nun bald ausgewechselt werden.
Dieses war mein Stichwort, denn gerade von einem solchen Seil, es hatte insgesamt eine Länge von 1600 m, brauchte ich ein Stück von ca. 450 m.
Herr K. hatte volles Verständnis für meinen Wunsch und hielt ihn für durchaus realisierbar. So hinterliess ich ihm also meine Anschrift, schickte ihm auch später noch einen adressierten Freiumschlag und hörte monatelang nichts mehr.
Dann aber meldete sich eines Tages die Mannheimer Sektion des Alpenvereins mit einem günstigen Angebot und gab mir einen Termin in den Sommerferien, an dem eine Gruppe von Mitgliedern zum Arbeitseinsatz auf der Oberzalim-Hütte sein würde. Auf diese Weise kamen wir schliesslich in Valegiascia zu einem neuen Tragseil.
Es wurde dann eine leichte, genussreiche Wanderung, aus der ich mich noch an die „Heinrich Hüter-Hütte“ erinnere, welche im Umbau begriffen war. Das neue Dach war ebenso unfertig wie die Schlafräume, und wir schliefen zwar in einem Bett, aber unter freiem Himmel. Früh am Morgen weckten uns die Hammerschläge der Zimmerleute, und wir wanderten weiter. Ein unerwartetes Zusammentreffen bescherte uns Bergschratten eine Begegnung mit der Zivilisation, sogar mit der Kultur. Auf einer verhältnismässig bequemen Hütte, welche sich in Stil und Leitung von den spartanischen Hochgebirgshütten wohltuend unterschied, trafen wir einen Mann, welcher mit seinem kleinen Auto über ein abenteuerliches Strässchen von dem knapp 1000 m tiefer gelegenen Vaduz, der Hauptstadt Liechtensteins, herauf gefahren war. Dieser nahm uns freundlicherweise mit hinunter nach Liechtenstein, wo wir uns die fürstliche Gemäldesammlung im Schloss ansahen. Ich erinnere mic an riesige Gemälde von wilden, dramatischen Schlachtenszenen und prächtige Rembrandt-Portraits von fülligen Barockdamen, die auch nicht nach unserem Gusto waren. Aber auch Rembrandts berühmtes Kinderbildnis hängt dort, und wer hat denn schon jemals die fürstliche Gemäldesammlung in Vaduz besichtigt?
Am nächsten Tag kletterten wir schon wieder auf den felsigen Gipfeln der „Drei Schwestern“ herum, und Herbert wies mich in die Kunst des Abseilens ein.
Diese Tour habe ich in besonders freundlicher Erinnerung behalten.
Ganz anders verlief unsere Tour zum Ortler, damals meinem ersten Viertausender. Wir hatten uns oberhalb von Meran, in dem schmucken touristischen Ort im Tirol, einquartiert, wo Herbert mit seiner Christa schon einmal Urlaub gemacht hatte. Von dort fuhren wir nach Innersulden am Ortler und stiegen zur Payer-Hütte auf. Diese war erstaunlicherweise schon 80 Jahre vorher in zirka 3000 m Höhe von alpinen Idealisten mit einem kaum vorstellbaren Einsatz an Körperkräften in einen zackigen Felsgrat hinein gebaut. Sie steckte dort recht abenteuerlich wie in einem hohlen Zahn und war auch nur nach langem Anstieg und über einen schmalen Grat zu erreichen. Um die Hütte herum gab es kaum einen Quadratmeter ebene Fläche, wo man sich zum Feierabend hätte aufhalten können. Der garstige, rothaarige Hüttenwirt hiess in origineller Weise Herr Ortler und war bei allen Alpinisten der Welt für seine Unhöflichkeit bekannt. Nur beim Kassieren wurde er von einer milderen Stimmung übermannt. Erstaunlich war, dass 2 freundliche Haustöchter es die ganze Saison über bei ihm in diesem Wolkenkuckucksheim aushielten.
Wenn man hinter der Hütte einen Blick in die Tiefe warf, musste man mit Abscheu feststellen, dass eine ganze Senke zwischen den Felsen mit Hunderttausenden von leeren Getränkedosen gefüllt war. Ich könnte mir denken, dass bei dem heutigen Niveau des Umweltbewusstseins inzwischen diese Scheusslichkeit beseitigt wurde. Wir hatten unseren Aufstieg bei sehr unsicheren Witterungsverhältnissen gemacht, und tatsächlich wurden wir am nächsten Morgen nicht rechtzeitig geweckt. Der Aufstieg zum Gipfel des Ortlers war vom Hüttenwirt wegen schlechten Wetters nicht freigegeben worden. Also stiegen wir wieder ab und fuhren nach dem nahen Meran. Dort spazierten wir in unserem Bergsteiger-Outfit über die elegante Kurpromenade. Der Kontrast zwischen diesem zuckersüssen Ambiente und der schroffen, kargen Bergwelt war geradezu atemberaubend. Wir entschlossen uns sogar zum Besuch einer angekündigten Veranstaltung für die Kurgäste, einem bayrischen Volksabend. Obwohl ich 3 Jahre in München gelebt habe, hatte ich diesen komprimierten Kitsch noch nie gesehen, hatte aber an den „Goasslschnalzern“ und Schuhplattlern doch ein wenig Spass.
Am nächsten Tag stiegen wir wieder zur Payer-Hütte auf, und dieses Mal klappte es, wenn auch bei keineswegs idealem Wetter.
Nach Überqueren einer ausgedehnten Eisplatte, was ohne Steigeisen gar nicht möglich war, begann eine ziemlich senkrechte Kletterei, bis man oben den Gletscherschnee erreicht hatte. Als Zweierseilschaft waren wir schneller als die Vierer- und Fünfer-Seilschaften und überholten alle, die vor uns aufgebrochen waren. Der weitere Aufstieg, obwohl an imponierenden Gletscherformationen- und spalten vorbei, war einfach und nur Konditionssache. Wir waren nur in den Wolken, d. h. im Nebel aufgestiegen. Akkurat in der Minute, als wir den Gipfel erreichten, riss der Nebel für die kurze Zeitspanne von etwa 5 Minuten auf, und die Sonne beschien die gewaltige Szenerie und den Blick ins Tal. Es war wie eine extra für uns knapp zugemessene Gabe des Himmels.
Am nächsten Tage nahmen wir ein angenehmes Privatquartier in Innersulden und stiegen bei gutem Wetter von der mit einer Seilbahn erreichten Rombach-Hütte über Gletscher und einen kleinen Pass zur Cassati-Hütte auf. Es ist eine grosse, altertümliche Hütte, welche auch für den Wintersport auf dem Cevedale-Gletscher gebaut war. Als wir dort ankamen, war sie mit 100 Kindern und Jugendlichen so überfüllt, dass wir nicht einmal einen Platz fanden, um unsere Rucksäcke abzustellen, geschweige denn, zum Hüttenwirt vorzudringen. Bei dem Gedanken, wie wir hier den Abend und die Nacht verbringen sollten, waren wir erst einmal frustriert. Aber es löste sich dann alles in Wohlgefallen auf, denn es handelte sich nur um den Tagesausflug einer Schule. Die Kinder waren von der anderen Seite aufgestiegen, und, bevor sie sich auf den Abstieg begaben, sangen sie einige sehr schöne Chorlieder, welche die Alpini im ersten Weltkrieg gesungen haben und die, im Gegensatz zu deutschen Soldatenliedern, von ergreifend melodiösem Wohlklang sind.
Wir konnten die endlos lange Gruppe, welche sich auf schmalem Pfad die steilen Berge hinabschlängelte, noch lange mit unseren Blicken verfolgen, und es trat Abendfrieden auf der Hütte ein. Ich erinnere mich an einen wunderschönen Sonnenuntergang über der weiten, eisigen Gletscherlandschaft und ahnte nicht, dass ich am nächsten Tag etwas erleben würde, worüber ich noch heute, nach einigen Jahrzehnten, nicht ohne einiges Missbehagen berichten kann.
Es war ein schöner Morgen, an dem wir den fast 3800 m hohen Cevedale, auf Deutsch „Zufallspitze“, besteigen wollten. Herbert wollte uns anseilen, aber ich wollte das lästige Seil nicht, und die Tour sah auch nicht sonderlich schwierig aus. Ich überredete ihn schliesslich dazu, das Seil bei der Hütte zu lassen. Das war falsch von mir, aber es wäre folgenlos geblieben, wenn dann nicht auch Herbert einen Fehler gemacht hätte.
Man pflegt auf den Gletschern den Trampelpfaden zu vertrauen, welche man vorfindet, ist sich aber bewusst, dass das keine wirkliche Sicherheit gegen die Gefahren von Gletscherspalten ist. Wir stiegen also auf den Trampelpfad unserem Ziel entgegen, als plötzlich eine einzelne Trittspur links abzweigte und eine direktere Richtung auf dem Einstig zum Gipfel nahm. Dieser folgte Herbert, und wir erreichten eine Stelle, die uns verdächtig erschien. Herbert kroch auf allen Vieren darüber. Ich machte es ebenso, war aber schwerer als Herbert. Plötzlich brach unter meinen Knien das dünne Eis, und ich konnte mich gerade noch mit den Händen über die Kante ziehen. Ich hätte keine Überlebenschance gehabt, denn ehe Herbert von der inzwischen zu weit entfernten Hütte hätte Hilfe holen können, wäre es für mich zu spät gewesen, abgesehen davon, dass er über die Spalte hätte zurück müssen. Man überlebt in einer Gletscherspalte nicht länger als maximal eine dreiviertel Stunde, und auch das nur, wenn man sich beim Sturz nicht schwer verletzt hat. Wie gut, dass Renzi nichts davon wusste; für sie war ich eine Woche lang so unerreichbar, wie auf dem Mond.
Nun, wir hielten uns nicht weiter mit unnützen Gedanken oder Reden auf und begaben uns an den Anstieg. Wir hatten uns nicht den leichten ausgesucht, sondern den gefährlichsten meines Lebens. (Als Bergsteiger spricht man allerdings nicht von gefährlich, sondern von ausgesetzt). Ein extrem steiler, schmaler, schneebedeckter Eisgrat, auf dem man es besser vermied, neugierige Blicke rechts oder links zu riskieren, führte auf den einen der beiden Gipfel, und ich erinnere mich an ein gewisses Hochgefühl, als über Fünfzigjähriger diese Leistung geschafft zu haben. Alles Weitere verlief normal: wir trennten uns in Innersulden, und ich fuhr über das Stilfser Joch, wo ich an der Strassenböschung einen schönen Alpenblumenstrauss pflückte, den ich meiner Renzi nach Esslingen mitbrachte, wo sie sich gerade aufhielt.
Auf einer weiteren, höchst eindrucksvollen Tour führte Herbert mich in die Adamello-Gruppe in den Dolomiten. Er hatte diese Tour ausgesucht, weil sie nicht zu den in der Hochsaison überlaufenen alpinen Highlights gehört und in der Fachliteratur von stillen, empfehlenswerten Hütten die Rede war.
Ich kann keine Karte mehr lesen und meinem Gedächtnis damit nicht zu Hilfe kommen. Wir hatten uns wie immer ohne Schwierigkeiten getroffen und waren hintereinander zu einer ersten Unterkunft gefahren. In diesem Bereich gab es angeblich noch Bären, und die Zuwege waren so abenteuerlich, dass wir ein Auto stehen liessen und mit dem anderen weiterfuhren, während wir auf das Auftauchen eines Bären aus der undurchdringlichen, grünen Wildnis gefasst waren. Aber ausser dieser erinnere ich mich an einen ganz anderen Zugang zu unserer Tour.
Das war eine Hütte, welche von einer bequemen Strasse aus erreichbar war, und da wir an einem Sonntag starteten, war diese Hütte mit Tagesausflüglern überfüllt. Wir machten dort nur eine Mittagsrast und wanderten weiter zum Rifugio della Lobbia alta, wo wir die erhoffte Einsamkeit vorzufinden gedachten. Diese Hütte ragte eindrucksvoll wie ein tibetanisches Kloster aus einem steilen Felsenhang hervor, welcher seinerseits aus einem ausgedehnten Gletscher aufstieg. Die Hütte war zu unserer Enttäuschung mit Bergwanderern derartig überfüllt, dass wir nur mit Mühe ein Quartier bekamen. Im Laufe des Abends kamen wir dann dahinter, was diese wenig bekannte und keineswegs komfortable Hütte plötzlich zu einer Attraktion gemacht hatte: Papst Karol Woytila hatte kürzlich hier einen Skiurlaub verbracht, was natürlich durch die gesamte italienische Presse veröffentlicht worden war. An den Wänden waren einige frische Fotos von diesem Ereignis befestigt, auf welchen man z. B. den Papst als Skifahrer brüderlich umrahmt von 2 Skilehrern sah. Von dieser Hütte aus unternahmen wir unsere Tagestouren, welche sich die ganze Woche ausschliesslich auf Gletschern abspielten.
Diese sind im Sommer nicht immer schön und weiss, sondern z. T. garstige, schmutzige, kreuz und quer gerissene und zerfurchte ausgedehnte Eisflächen, aber in höheren Lagen und auf den Gipfeln war schöner, weisser Schnee. Die Gletscherlandschaft präsentiert aber auch imponierende Gebilde, Tore, Höhlen und elegante Brücken, u. Ä. Eine riesige Kanone aus dem Ersten Weltkrieg, welche von Tausenden geschundener Soldaten hier hinauf geschleppt worden war, zeugt noch heute, nach bald einem Jahrhundert, von dem grausigen Kriegsgeschehen unter unmenschlichen Bedingungen. Nach dieser Tour habe ich mich in einem Buch über die jahrelangen verbissenen und entsetzlich verlustreichen Kämpfe zwischen den österreichischen Gebirgsjägern und den italienischen Alpini informiert. Es ist unfassbar, was sich dort oben für Dramen abgespielt haben und welch unglaubliches Heldentum damit verbunden war.
In wochenlanger Arbeit bohrte man mit primitiven Mitteln einen Stollen in einen Berg, auf dessen Gipfel sich ein feindlicher Beobachtungs- und Leitstand in uneinnehmbarer Position befand. In diesen Stollen transportierte man eine ganze Eisenbahnladung Sprengstoff und sprengte den ganzen Gipfel des Berges in die Luft. Es wurde keinerlei Rücksicht auf die sogenannt objektiven Gefahren im Gebirge genommen, wie Unwetter und Schneesturm, Steinschlag und Lawinen, und Hunderttausende von Soldaten auf beiden Seiten fielen diesem idiotischen Krieg um diesen oder jenen Bergesgipfel zum Opfer. Die Kämpfe waren so verbissen und abseitig, dass das offizielle Ende des Ersten Weltkrieges im November 1918 nicht zur Kenntnis genommen und noch eine ganze Weile weitergekämpft wurde.
Als wir nach einer Woche in Schnee und Eis wieder auf dem Abstieg auf den grünen Bergwiesen, welche mit blühenden Sommerblumen übersät waren, ankamen, war ich von dieser Schönheit tief bewegt.
Von unserer Bergtour ins Berner Oberland sind mir nur wenige Bilder im Gedächtnis geblieben. Das Oberland mit den 3 markanten Viertausender-Gipfeln Eiger, Mönch und Jungfrau, welche bei guter Alpensicht auch von manchem nahegelegenen Aussichtspunkt im Schwarzwald zu sehen sind, ist von Lörrach D in knapp 2 Stunden zu erreichen, und so habe ich dort auch mit anderen Begleitern und Gruppen manche Bergtour gemacht.
Für Herbert war es von Coburg eine weite Anreise, und wir hatten uns in Kandersteg getroffen, um auf das Balmhorn zu steigen. Von dieser Tour ist mir nur in Erinnerung geblieben, dass 2 junge Bergsteiger kurz nach uns auf dem Gipfel eintrafen. Sie falteten ihre handlichen Rucksäcke auseinander und machten Gleitschirme daraus. Und dann erlebten wir neidvoll, wie sie sich in dreieinhalbtausend Meter Höhe vom Gipfel in die Lüfte warfen und wie grosse Vögel hinunterschwebten, während wir uns an unseren vierstündigen, mühseligen Abstieg auf steilen, Felspfaden machten. Am nächsten Tag trennte ich mich, ich weiss nicht mehr, aus welchem Grunde, von Herbert, welcher zum Hohtürli-Pass aufstieg.
Ich fuhr eine Station mit der Eisenbahn, übernachtete irgendwo allein und stieg am nächsten Morgen vor Tau und Tag von der anderen Seite zum Hohtürli auf und traf Herbert zu seinem grossen Erstaunen in dem Moment wieder, als er gerade gut ausgeschlafen und gefrühstückt aus der Hütte trat. Was wir dann noch gemacht haben, weiss ich nicht mehr. Jedenfalls kaufte ich mir in Kandersteg Shorts und ein T-Shirt, in welchen Dress ich mir sehr schick vorkam und welcher auch Herberts Billigung fand.
Eindrucksvoller waren einige Tage in der Bergsteigerschule im Hans-Berger-Haus im Wilden Kaiser. Hier hatte Herbert schon als Berglehrer fungiert, kam aber nun mit mir als Urlauber. Wir hatten uns in Kufstein getroffen und einen netten Abend in einem der schönen, behäbigen Gasthöfe verbracht, bevor wir am nächsten Morgen zur Hütte aufstiegen. Herbert sah beeindruckend aus, oben bärtiger denn je, und unten in einer äusserst knappen, himmelblauen Shorts.
Die Hütte war gross und schön im Lärchenwald gelegen, aber sie hatte den Nachteil, dass man morgens immer zuerst 600 Höhenmeter, d. h. mehr als eine Stunde aufsteigen musste, bevor man die Klettertouren im Fels beginnen konnte.
Aber schon am nächsten Tage war die erste Felskletterei meines Lebens fällig. Es ist dies etwas völlig anderes als das, was man Bergsteigen nennt. Ich befand mich schon bald vor einer senkrechten Felswand, vor der ein normaler Bürger niemals das Bedürfnis empfinden würde, dort hinauf zu wollen. Aber Herbert kletterte hinauf wie ein Affe und verschwand, so dass nur noch das Seil an ihn erinnerte, mit dem ich angeseilt war. Nun war es an mir, die Entdeckung zu machen, dass eine solche Felswand Vorsprünge und Löcher hat, die geeignet sind, sich mit Händen und Füssen daran hinaufzubewegen. Ich wusste zwar, dass mir nicht viel passieren konnte, da er mich am Seil gesichert hatte, aber für einen Fünfzigjährigen zum ersten Mal empfand ich es doch als eine Zumutung.
Er hatte gesagt, wenn ich nicht weiter könne, sollte ich „Zug!“ rufen, aber das liess mein erwachter Ehrgeiz dann doch nicht zu. Schon bald gewöhnte ich mich an dieses neue Ambiente und erreichte ohne „Zug!“ den Gipfel, wo Herbert mich mit einem kernigen „Berg heil, Thomas!“ begrüsste. Für den nächsten Tag hatte Herbert sicher eine anspruchsvollere Tour vorgesehen, der ich mit gemischten Gefühlen entgegensah. Aber ich wurde immer besser, und am 3. Tage regnete es in Strömen. Nachdem ich mich den ganzen Vormittag auf der Hütte gelangweilt hatte, machte ich mich auf eine einsame Wanderung. Ich stieg eine Stunde im rauschenden Regen durch den Bergwald auf und gelangte auf eine baumlose Hochebene. Der Regen war inzwischen in ein heftiges Gewitter übergegangen, und ich war in der Ebene der geeignete Anziehungspunkt für die Blitze. Aber ich erreichte ein behagliches Hüttenrestaurant, in dessen Nähe die Bergstation einer Seilbahn aus Kufstein war. Mit dieser Bahn war eine muntere Mädchenklasse mit ihrem Lehrer heraufgekommen, und diese sass in einer geräumigen Nische auf einer hufeisenförmigen Bank. Die Mädchen waren nassgeregnet und fröhlich und sangen wunderschön. Damals war das Kufstein-Lied, welches bald die Welt eroberte, ganz neu, und die Szene war filmreif. Die jungen Mädchen in ihrem bayrischen Outfit hatten einen so hinreissenden, fröhlichen Schwung, und das dort oben in der einfachen Berghütte, weit ab vom kitschigen Odium des Musikantenstadls; ich habe es nie vergessen können und immer ein kleines, schmerzliches Bedauern darüber empfunden, dass ich es nie wieder erleben würde.
In unserem Hans-Berger-Haus lief ein Kletterlehrgang, und jeden Nachmittag kehrte die Gruppe von ihrer Tour zurück. Dass auch einige junge Frauen dabei waren, verwundert heutzutage im Zeitalter von Frauenfussball und Frauenboxen niemand, aber vor einem halben Jahrhundert mutete mich der Anblick der total erschöpften Frauen mit roten, überanstrengten Gesichtern und von Schweiss und ausgestandener Angst gezeichneten Augen absurd an. Aber sie waren glücklich und stolz und gingen am nächsten Morgen wieder los, um zu lernen, wie man ohne Hilfsmittel in Felskaminen hochklettert.
Am Ende des Lehrgangs gab es einen zünftigen Hüttenabend mit einer virtuosen Jodlerin und anderen frohsinnigen Zeitvertreiben.
Die letzte der hier geschilderten Bergtouren führte uns in den Catenaccio in Südtirol, zu Deutsch: den „Rosengarten“, denn ein sagenhafter Zwergenkönig Laurin hatte hier einen solchen, der zu Stein geworden ist und an welchen nur noch die bei Sonnenauf- und Untergang rot leuchtenden Felsen erinnern. Dass dieses unsere letzte gemeinsame Tour war, hatte seinen Grund darin, dass Herbert seine blutjunge Anette heiratete und mit ihr Hand in Hand ein neues Leben begann, so dass er mir für weitere riskante Eskapaden nicht mehr zur Verfügung stand.
Er hatte diese letzte Tour eigentlich im Karwendel-Gebirge geplant, aber dort fanden wir so schlechtes Wetter vor, dass wir über den Brennerpass auf die Alpensüdseite fuhren. Der Rosengarten ist bekannt für seine Klettersteige in allen Schwierigkeitsgraden. Über eiserne Leitern und an Drahtseilen zum Festhalten gelangt man in Felspartien, die einem nicht einmal im Traum einfallen würden. Da gibt es Felstürme und Abgründe, wo kein Fuss stehen kann und wohin man nur durch die Hilfsmittel gelangen kann. Für etliche dieser Klettersteige muss man schon ziemlich abgebrüht sein, denn man hat nicht immer für Hände undFüsse einen Halt.
Ein Hagelsturm überraschte uns, und es war unser Glück, dass wir festen Fels unter den Füssen und ein Drahtseil zum Einklinken hatten. Wir gingen von Hütte zu Hütte, von denen eine recht exponiert auf dem abgeflachten Gipfel eines Felsturmes stand.
Überall in den Alpen kommt man als Bergsteiger an Ansammlungen von Gedenktäfelchen an einer Felswand oder einem grossen Stein vorbei, welche Bergsteiger und Felskletterer zum Gedenken an einen abgestürzten Bergkameraden angebracht haben.
Beim Bergsteigen ist es zwar bei Weitem nicht so gefährlich wie im Krieg an der Front, aber man muss doch zufrieden sein, dass man nicht als Täfelchen am Gedenkstein hängt, sondern am PC seine Erinnerungen aufschreiben kann.
Im September 2009